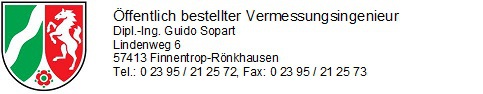weitere Vermessungsverfahren
Astronomische Vermessung:
Astronomische Vermessungsverfahren wurden schon vor Jahrtausenden von den ersten Seefahrern zur Navigation eingesetzt, wobei sich die Berechnungsmethoden und vor allem die Messinstrumente mit dem Wandel der Technik verändert haben. Das Grundprinzip der astronomischen Vermessung entspricht jedoch noch den Navigationsmethoden der Seefahrer. Aus der Beobachtung der Gestirne wird die aktuelle Position auf der Erde abgeleitet bzw. Richtungen, bezogen auf die geographische Nordrichtung (= Azimut) bestimmt.
Die wichtigsten Messverfahren sind:
- Azimutbestimmung und Bestimmung der astronomischen Breite durch die Beobachtung des Polarsterns
- Berechnung von Länge, Breite und Azimut aus Sonnenbeobachtungen
- Breitenbestimmung nach der Sterneckmethode
- Bestimmung der astronomischen Länge und Breite mit Hilfe von Beobachtungen im gleichen Almukantarat.
Triangulation:
Die Triangulation ist ein Vermessungsverfahren, welches auf der Beobachtung von Dreieckswinkeln basiert. Um einen Maßstab zu definieren, wird auf mindestens einer Dreiecksseite des Netzes eine Streckenmessung durchgeführt.
Mit Hilfe der Triangulation entstand das als Landessystem bekannte Vermessungsnetz der Preußischen Landesaufnahme. Ausgehend von dem Zentralpunkt „Rauenberg (Berlin)“, dessen Länge, Breite und das Azimut zu einer ersten Anschlussrichtung astronomisch bestimmt wurden, wurde in ganz Deutschland ein aus Dreiecken bestehendes Netz von trigonometrischen Punkten beobachtet. Der Maßstab dieses flächendeckenden Netzes wurde aus fünf, in verschiedenen Netzteilen durchgeführten Basismessungen (Streckenmessungen) abgeleitet. Nach Abschluss der Messungen hat man die, aus der ersten Bestimmung entstandenen Dreiecksmaschen mehrmals verdichtet, so dass man heute auf ein engmaschiges Netz aus trigonometrischen Punkten zurückgreifen kann.
Heute werden Vermessungen im Netz der trigonometrischen Punkte fast ausschließlich mit den Verfahren der Satellitenvermessung durchgeführt und in großen Ausgleichungsblöcken berechnet.
Schweremessungen:
Schweremessungen sind, wie bereits dargestellt, zur Definition eines Höhensystems und zur Reduktion nivellierter Höhenunterschiede von elementarer Bedeutung. Daher unterhält die deutsche Landesvermessung neben den Lage- und Höhenfestpunktfeldern auch ein Schwerefestpunktfeld. Die Entstehung des deutschen Schwerefestpunktfeldes geht auf das Jahr 1909 zurück. Damals führte das Geodätische Institut Potsdam Absolutschweremessungen in Potsdam und ausgehend von diesen Bestimmungen Relativschweremessungen auf ca. 2400 Punkten weltweit durch.
Das aktuelle Schwerenetz der deutschen Landesvermessung stützt sich auf Schweremessungen zwischen 1978 und 1982. Die Grundlage dieses System bilden Absolutschweremessungen auf Stationen in Hamburg, Braunschweig, Wiesbaden und München. In den Folgejahren wurde dieses Schwerenetz erneuert und die Schwerewerte angepasst.
Bei Schweremessungen unterscheidet man Absolutmessungen und Relativmessungen.
Absolutgravimeter arbeiten nach dem Prinzip des freien Falls und bestimmen den absoluten Schwerewert des Messpunktes. Gemessen werden Durchlaufzeiten einer Prüfmasse im freien Fall durch festgelegte Ebenen. Da Absolutschweremessungen jedoch sehr aufwendig sind, werden sie sehr selten durchgeführt.
Relativgravimeter bestimmen den Schwereunterschied zwischen zwei Messpunkten. Sie arbeiten nach dem Prinzip einer Federwaage und messen die Auslenkung einer, an einer Feder befestigten Prüfmasse. Die Schwereänderung von einem Messpunkt zum Ausgangspunkt ergibt sich aus dem Grad der Auslenkung bezogen auf die im Ausgangspunkt eingestellte Nullstellung.
zurück zu "Die Vermessung der Welt"